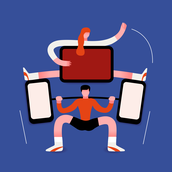In den Schulministerien der Länder klingt es vor allem nach: »Das haben wir doch ganz gut hinbekommen!« In den Schulen dagegen (und auch bei vielen Eltern) gibt es deutlich kritischere Stimmen: Eine Grundschullehrerin empfindet die Hofpausen derzeit als »Massentierhaltung« und beobachtet bei den Kindern Verunsicherung und Frustration (»Debatte der Woche«).
Eng damit zusammen hängt die Frage, was sich denn konkret in den Schulen ändern muss. Klar, die Baustellen Digitalisierung und Chancengerechtigkeit sind bekannt – aber bei genauerem Hinsehen fragt man sich schon, wie es zum Beispiel sein kann, dass die Gelder für Endgeräte, die Schülerinnen und Schülern die problemlose Teilnahme am Fernunterricht garantieren soll, so ungerecht läuft (»Das ist los«).
Das Team von »Kleine Pause« wünscht Ihnen eine gute Zeit – und wenn Sie etwas haben, das wir uns mal genauer anschauen sollten, erreichen Sie uns hier für Feedback & Anregungen.
Susmita Arp, Silke Fokken, Armin Himmelrath
Das ist los
1. 500 Millionen, ungerecht verteilt
Gut gemeint ist eben nicht automatisch gut gemacht: Die 500 Millionen Euro, mit denen bedürftige Schüler für die Teilnahme am digitalen Unterricht ausgestattet werden sollen, werden ziemlich ungerecht verteilt. Das befürchtet jedenfalls der SPD-Bildungspolitiker Ernst Dieter Rossmann.
Es sei zwar gut, dass die Bundesregierung das Geld zur Verfügung stelle, sagt Rossmann. Aber: »Es wird überhaupt nicht berücksichtigt, wie viele Kinder und Jugendliche in einem jeweiligen Bundesland von Armut betroffen sind. Da gibt es extreme Unterschiede. Die Verteilung der Gelder ist deshalb dramatisch ungerecht.«
Rossmann hat ausgerechnet, dass für ein bedürftiges Kind in Bayern fast 1000 Euro bereitgestellt werden - in Bremen dagegen nur 228 Euro. Und Schuld daran sind nicht die jeweiligen Landesregierungen. Wie Rossmann auf diese Zahlen kommt, hat er uns im SPIEGEL-Interview verraten.
Kleines Schmankerl zu den Digitalisierungsbemühungen am Rande: In Berlin sollen die Lehrerinnen und Lehrer 2021 alle eine eigene Dienst-E-Mail-Adresse bekommen – der »Tagesspiegel« hat darüber berichtet. Wenn’s tatsächlich so kommt, dann wäre die Hauptstadt zumindest in diesem Punkt nicht mehr das Schlusslicht unter den Bundesländern.
2. Tolle Schülerinnen und Schüler
Im Namen des Forschungsreisenden Wilhelm Filchner wollten sie nicht mehr länger lernen: Schülerinnen und Schüler im hessischen Wolfhagen haben den Anstoß dafür gegeben, dass ihre Schule nicht mehr nach einem Forscher benannt ist, der zu den Gründungsmitgliedern der sogenannten Gesellschaft für Rassenhygiene gehörte und sich nie vom Nationalsozialismus distanzierte.
Stattdessen heißt die Schule seit voriger Woche Walter-Lübcke-Schule und erinnert damit an den CDU-Politiker und Landrat, der sich für eine humane Flüchtlingspolitik engagiert hatte. Was seine Witwe Irmgard Braun-Lübcke und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier beim Festakt zur Umbenennung sagten, können Sie hier lesen.
3. Was sonst noch war
Bei Familie Kähler in Bayern wird gerade viel über die Situation in der Schule gesprochen. Denn wie man mit den Lüftungsvorgaben und den Hygieneregeln umgeht, darüber herrscht an den beiden Gymnasien der Jugendlichen keine Einigkeit: Der eine Sohn friert täglich im Durchzug, der anderen sitzt mit Schutzmaske im Klassenraum, weil über Stunden gar nicht gelüftet wird.
Die Situation der Kählers ist damit fast so etwas wie ein Sinnbild für den Kriterien-Wirrwarr, den es in Sachen Corona an den Schulen derzeit gibt. Silke Fokken und Heike Le Ker haben zusammengetragen, was wir über die pädagogische Königsdisziplin der kommenden Monate, das Lüften, schon alles wissen – und was nicht.
Hinweisen möchten wir außerdem noch auf die Umfrage des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), der bei rund 1300 Schulleitungen erhoben hatte, wie es mit psychischer und physischer Gewalt gegen Lehrkräfte in ihren Einrichtungen aussieht. Obwohl es einige kritische Anmerkungen insbesondere zur Methodik der Studie gab, ist der Trend dennoch besorgniserregend: Die Meldungen über Vorfälle habe seit der letzten Umfrage vor zwei Jahren zugenommen.
Und wenn Sie noch kurz nach Süden schauen möchten: Der Schweizerische Rundfunk SRF hat ein interessantes Interview mit einer Jugendpsychiaterin geführt, die sagt: »Vielen ging es während des Lockdowns besser.« Das Gespräch können Sie hier nachlesen und –hören.
Debatte der Woche
Lief es gut in den ersten Wochen des jetzt nicht mehr ganz so neuen Schuljahrs? Ja klar, nicken die Kultusministerinnen und -minister. Stefanie Hubig etwa, die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, gibt sich betont optimistisch: »Wir wollen in diesem besonderen Schuljahr so viel Schule in Schule wie möglich machen. Denn: Unsere Schülerinnen und Schüler haben ein Recht auf Bildung in ihrer Schule. Darüber gibt es in der Ländergemeinschaft einen breiten Konsens. Mit dem angepassten Hygieneplan schaffen wir einen einheitlichen Rahmen, der es weiterhin erlaubt, lokal und regional entsprechend zu handeln.«
»Kleine Pause«-Leserin Katja S. ist Lehrerin an einer Grundschule und betreut in diesem Jahr eine erste Klasse als Klassenlehrerin. Ihre Bilanz zum Schuljahr nach Corona fällt nicht ganz so positiv aus:
»Für die Kleinen bedeutet Schule mit Corona vor allem ganz viele Regeln und Verbote. Einerseits macht das die Kinder etwas demütiger und sie fragen lieber einmal zu viel um Erlaubnis für irgendwas. Aber es verunsichert und frustriert sie auch. Die Anliegen im wöchentlichen Klassenrat beschränken sich zum größten Teil auf die Coronaregeln – Mundschutz ist doof, nicht zu den großen Geschwistern und zu den Paten gehen zu dürfen ist doof und dass viele Hortangebote nicht stattfinden können, ist auch doof.
Für mich als Lehrerin bedeutet Corona vor allem wenig Zeit zum Durchatmen. Wir müssen die Kinder morgens vor der Schule abholen und schauen, dass alle einen Mundschutz dabeihaben und brav auf der rechten Treppenseite nach oben laufen, dann Hände waschen und dabei möglichst keinen anderen Klassenstufen begegnen. Alles ist getaktet und verregelt.
In die beiden täglichen Hofpausen muss ich die Klasse ebenfalls begleiten, damit alle im richtigen Hofbereich landen und die Klassenstufen sich nicht mischen. Ich muss dort warten, bis die Aufsicht da ist, damit die Kinder sich nicht raufen. Wenn die Pause vorbei ist, muss ich die Klasse wieder vom Hof abholen, wieder Hände waschen, wieder aufpassen, dass alle einen Mundschutz tragen, rechts laufen und die vorgeschriebenen Wege einhalten.
Für die Kinder bedeutet die Hofpause Massentierhaltung. Der Pausenhof ist in sechs Bereiche eingeteilt und jede Klassenstufe (sechsmal 100 Kinder) hat einen davon - im wöchentlich rotierenden Wechsel. Glück hat die Klassenstufe, die die Schaukeln UND das Klettergerüst hat. Pech für die armen Kinder, die nur die leere Pflasterecke haben. Der Hof ist nicht auf Corona-Bedingungen vorbereitet und es gibt deutlich mehr Pausenkonflikte und Unfälle. Die Aufsichten sind nur damit beschäftigt, Kinder in ihre Bereiche zurückzujagen und Raufereien zu verhindern, die durch Langeweile und den engen Raum entstehen.
Schlimm finde ich, dass ich mir vorkomme wie eine Verbrecherin, wenn ich mit den Kindern trotzdem das Lied zur Schreibtabelle singe, damit sie die Laut-Buchstaben-Zuordnung lernen, wenn ich Fritzchen trotzdem erlaube, Gretchen sein Lineal zu leihen oder ein Brot abzugeben, weil sie ihres vergessen hat; wenn ich Spiele spiele, bei denen verschiedene Kinder das Material berühren.
Was Corona uns auch Positives bringt?
Wir hatten eine grandiose Einschulung – im Fußballstadion mit Fanfarenzug, weil man da Abstand halten konnte und sogar Oma und Opa auf den Rängen Platz hatten. Die Kinder durften durch den Spielertunnel einmarschieren und haben auf dem Feld vor allen ihre Zuckertüte bekommen. Alle waren überwältigt.
Die Kinder wirken geerdeter. Die vielen Corona-Regeln machen demütig und lassen auch die Kleinen darüber nachdenken, was ihr Beitrag für die Gemeinschaft ist (gesund bleiben, niemanden anstecken, keinen unnötig gefährden).
Trotz der positiven Nebenwirkungen hoffen alle, dass die zweite Welle nicht kommt, dass Regelbetrieb wirklich Normalbetrieb ohne 1000 Regeln bedeutet und dass niemand ernsthaft krank wird.«
Mit einer anderen Perspektive schaut Natalie Stefanski auf dieses Schuljahr. Sie hat zwei Grundschulkinder in der 2. und 4. Klasse und sei derzeit »eine sehr besorgte Mutter in Corona-Zeiten«, schreibt sie:
»Der Teilzeitjob im Homeoffice, aber eben nur teilweise, die Kinder dieses Schuljahr nicht in der Betreuung, also sind immer Abholzeiten einzuhalten, meist bereits um 11.40 Uhr. Da fragt man sich schon oft: Wie soll der Stoff eigentlich nachgearbeitet werden? Keinerlei Flexibilität im OGS Alltag – trotz Corona! Daher auch die Abmeldung meiner Kinder aus der OGS, der Offenen Ganztagsschule.
Und darüber hinaus die desolate Klassensituation. So befinden sich 27 Schüler und Schülerinnen in der zweiten Klasse auf engstem Raum zusammen! Resultat: Mein jüngstes Kind will nicht mehr in die Schule – die ist blöd, zu voll und zu laut!
Dann zu Mittag Homeoffice mit zwei kleinen Kindern, ohne Hilfe und Unterstützung von irgendwem – so: Erst mal bis zehn langsam durchatmen und dann weiter…«
Gut zu wissen
"Wir dürfen nicht zum Status quo zurückkehren, sondern müssen Bildung besser machen", sagt OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher mit Blick auf die aktuelle Situation. So wie vor dem 16. März 2020, dem Tag der Schulschließungen, werde es nie wieder, prophezeit Schleicher und stützt sich dabei auf eine Sonderauswertung der Pisa-Daten. Was genau dabei herauskam, können Sie hier nachlesen.
Wir hoffen, Sie auch in dieser "Kleinen Pause" wieder mit vielen Anregungen und Informationen für die kommenden (Herbst-)Tage versorgt zu haben. Melden Sie sich gern bei uns, wenn Ihnen noch etwas auf den Nägeln brennt! Wir freuen uns über Post an kleinepause@newsletter.spiegel.de.