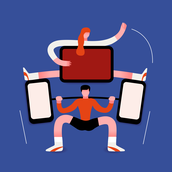Damit aber ist es seit vergangener Woche wieder vorbei. Sollen die Weihnachtsferien verlängert werden? Was Anfang Oktober noch unisono als wenig hilfreich zurückgewiesen wurde, gilt jetzt – in geringer Dosierung – als probates Mittel im Kampf gegen die Infektionen. Und das ist nicht der einzige Streitpunkt mit direkten Auswirkungen auf den Schulalltag (»Das ist los«).
Trotzdem wäre es natürlich wünschenswert, wenn alle Schulen zumindest theoretisch so gut ausgestattet wären, dass im Bedarfsfall ein problemloser Wechsel in den Fernunterricht möglich wäre. Sind sie aber nicht, zeigt der neue EU-Bildungsbericht (»Gut zu wissen«).
Doch trotz der Schwierigkeiten soll und muss es irgendwann wieder Zeugnisse geben. Nur: Auf welcher Basis kann und sollen sie erstellt werden? Eine Schulrechts-Expertin hat sich das Thema für uns einmal vorgeknöpft (»Debatte der Woche«).
Das Team von »Kleine Pause« wünscht Ihnen alles Gute in diesen Zeiten. Wenn Sie uns auf etwas hinweisen möchten, erreichen Sie uns unter kleinepause@newsletter.spiegel.de.
Silke Fokken, Armin Himmelrath, Swantje Unterberg
Das ist los
1. Der Solinger Weg bis ins Kanzleramt
Bei einer Inzidenzzahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, so empfiehlt es das Robert Koch-Institut, sollten Schulen über kleinere Lerngruppen nachdenken. Als der Inzidenzwert in Solingen die 280 überschritten hatte, wollte die Stadtspitze die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in ein Wechselschichtmodell schicken: die eine Hälfte zu Hause, die andere im Klassenzimmer. Stadt, Schulen, Eltern und Lehrkräfte fanden die Idee gut. Das Schulministerium in Düsseldorf allerdings nicht: Es verbot den Schichtunterricht.
Jetzt ist das Bergische Land nicht unbedingt für Rebellentum bekannt (obwohl sich die bergischen Bauern 1288 erfolgreich gegen den Kölner Erzbischof erhoben hatten). Doch in Sachen Schichtunterricht an Schulen kam es zumindest zu einem Miniaufstand. Die ganze Geschichte vom Gesamtschulleiter, der unbedingt seine Lerngruppen verkleinern wollte, können Sie hier nachlesen.
Das Schulministerium freilich ließ sich nicht beeindrucken. Und dazu passt durchaus der Kommentar der Kollegin Heike Schmoll in der »FAZ«, die argumentiert, ein Wechselmodell sei ebenso ungerecht wie die Verlegung des Unterrichts in den digitalen Raum. Hier ist ihr Text.
Das RKI und der Bund hingegen sehen rot: Die Infektionszahlen nehmen auch an Schulen zu. Das Bundeskanzleramt forderte deswegen gegenüber den Ministerpräsidenten ein Ende des regulären Präsenzunterrichts. Die Klassen sollten geteilt werden. Die Bundesländer sperrten sich erfolgreich – zumindest vorerst. Die Forderungen kommen mit Sicherheit auf Wiedervorlage. Grund genug, Sinn und Zweck der Maßnahmen noch mal zu analysieren.
2. Zahlenspiele I
Wie viele Schülerinnen und Schüler sind denn nun in Quarantäne? 300.000, schätzt Heinz-Peter Meidinger vom Deutschen Lehrerverband. Und zusätzlich noch 30.000 Lehrerinnen und Lehrer. Aber ob das wirklich belastbare Zahlen sind, sei dahingestellt.
GEW-Chefin Marlis Tepe jedenfalls hält die Zahl von 30.000 betroffenen Kolleginnen und Kollegen für »aus der Luft gegriffen«, auch VBE-Chef Udo Beckmann schließt sich der Kritik an Meidingers Schätzung an. Meine Kollegin Swantje Unterberg erklärt hier, warum es so schwer ist, seriöse Corona-Zahlen für die Schulen zu ermitteln.
3. Zahlenspiele II
In Deutschlands Klassenzimmern wird es in den kommenden Jahren wohl deutlich voller: Die KMK rechnet insgesamt mit mehr als elf Millionen Schülerinnen und Schülern bis 2030. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern – und an Schulgebäuden. Wie sich der erwartete Zuwachs von 986.700 Schülerinnen und Schülern bis 2030 verteilt, können Sie hier nachlesen. Und auch, welche Schulform als einzige nicht von dem Boom profitieren wird.
Gut zu wissen
Digital eher mau
Bei der digitalen Ausstattung liegen deutsche Schulen unter dem EU-Durchschnitt. Besonders drastisch ist die Lage an den Grundschulen von Klasse eins bis vier – so steht's im neuen EU-Bildungsbericht, dem »Education and Training Monitor«.
Der wurde am vergangenen Donnerstag von der EU vorgestellt – und kommt zu dem deprimierenden Ergebnis, dass nur neun Prozent der Kinder in Deutschland eine »gut digital ausgestattete und vernetzte Schule« besuchen. Das sind 26 Prozentpunkte weniger als im EU-Durchschnitt. Hier haben wir die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst.
Einzige Hoffnung: Die Daten beziehen sich auf das Schuljahr 2017/2018. Womöglich hat sich die Lage seither verbessert…
Debatte der Woche
Diktat und Mathetest am PC zu Hause schreiben?
Die Wiesbadener Rechtsanwältin Sibylle Schwarz hat sich Gedanken über Klassenarbeiten und andere Prüfungen im Corona-bedingten Fernunterricht gemacht.
Nach dem Unterricht kommt die Prüfung, klar. Im NRW-Schulgesetz, § 48, steht: »Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten.« In der hessischen Verordnung für die Schulen heißt es: »Schriftliche Arbeiten (…) beziehen sich in der Regel im Schwerpunkt auf Inhalte und Arbeitsmethoden einer abgeschlossenen Unterrichtseinheit, deren Lernziele durch vorbereitende Übungen hinreichend erarbeitet worden sind.« So weit, so klar.
Was aber, wenn Unterricht wegen der Covid-19-Pandemie gar nicht stattfand? Oder nur bruchstückhaft, weil zunächst lediglich Arbeitsblätter per Mail verteilt worden sind und später alle 20 Minuten gelüftet werden musste? Ohne ordnungsgemäßen Unterricht gibt es nämlich keine Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die in einer Klassenarbeit abgefragt werden könnten.
Ein Beispiel: Eine Grundschülerin erhielt für den Mathetest zu Hause die Auflage, allein in einem Raum vor dem PC zu sitzen. Schülerin, Arbeitsblatt und Zimmertür müssen gleichzeitig ständig im Bereich der Webcam und damit im Blick der Lehrkraft sein.
Das wirft Fragen auf – nach der technischen Ausstattung und nach den Wohnverhältnissen. Denn für Klassenarbeiten in der Schule reicht es, wenn die Kinder ihr Schreibgerät mitbringen. Bei einer Online-Klassenarbeit zu Hause dagegen brauchen sie einen Rechner, einen leistungsfähigen, ruckelfreien Internetzugang; einen Tisch in einem ruhigen, ungestörten Raum.
Was aber, wenn Familien das Geld dafür fehlt? Wenn Familien in beengten Verhältnissen leben? Wenn drei Schulkinder gleichzeitig zu Hause Online-Klassenarbeiten schreiben? Wenn sich die Grundschülerin und die im Homeoffice arbeitende Mutter Küchentisch und PC teilen müssen?
Und was ist, wenn – wie im Beispiel – die Grundschülerin allein im Raum ist, vielleicht sogar erstmals allein vor dem Rechner – und dann ist kurz das Internet weg? Vielleicht, weil sie sich irgendwie verklickt hat. Diese Situation hat die Grundschülerin noch nie geübt – das Ergebnis ihres Mathetests zählt aber trotzdem.